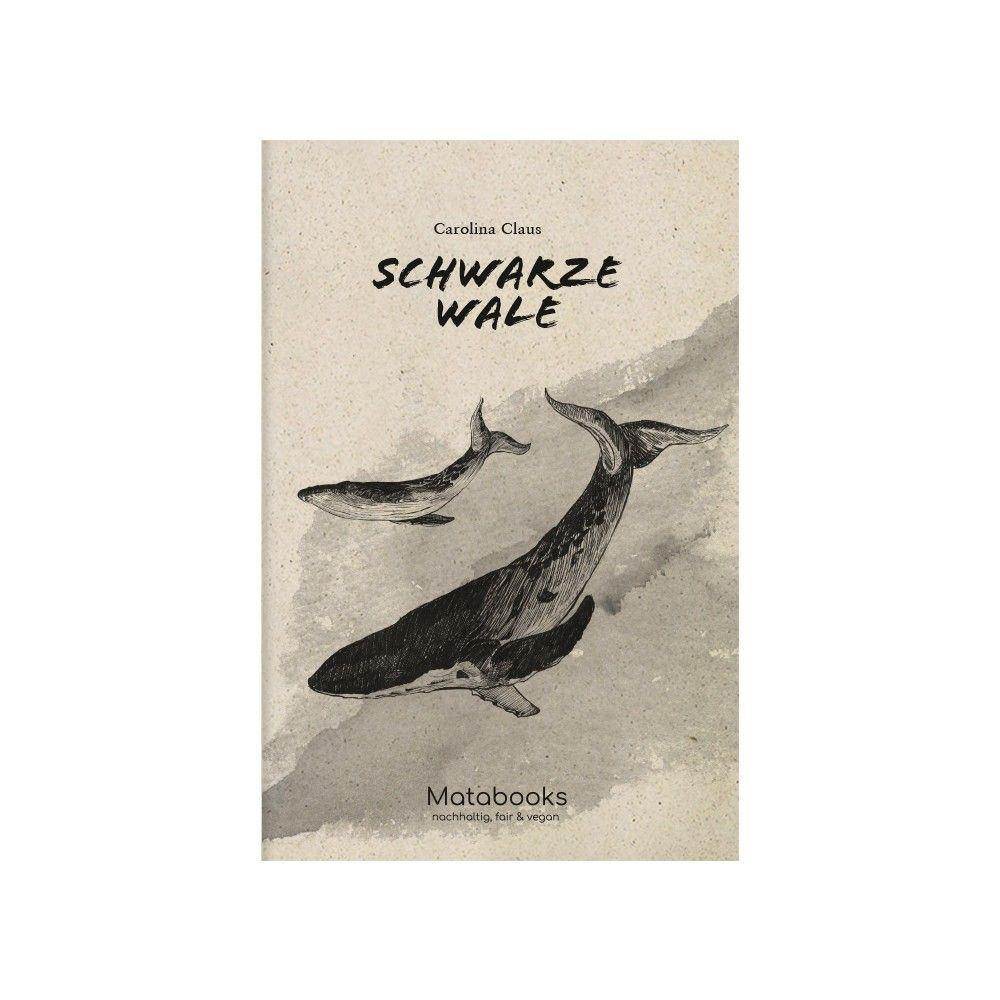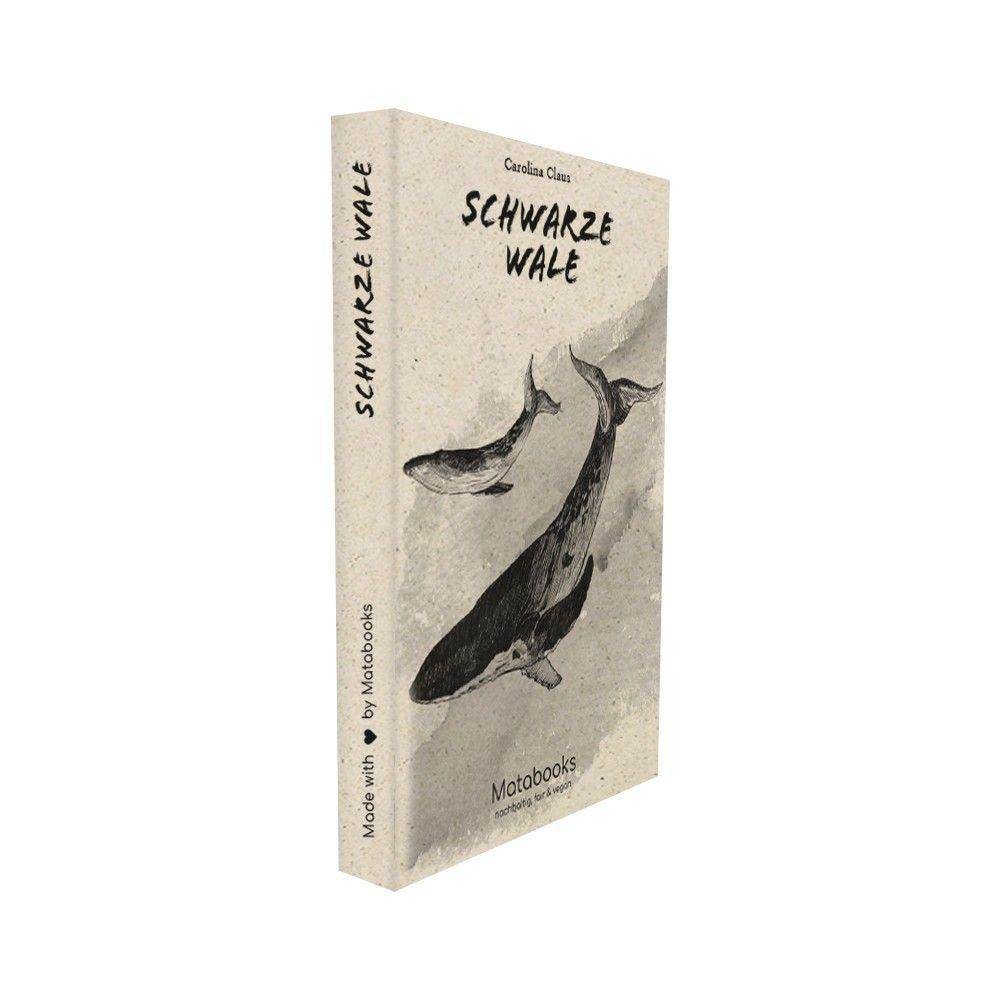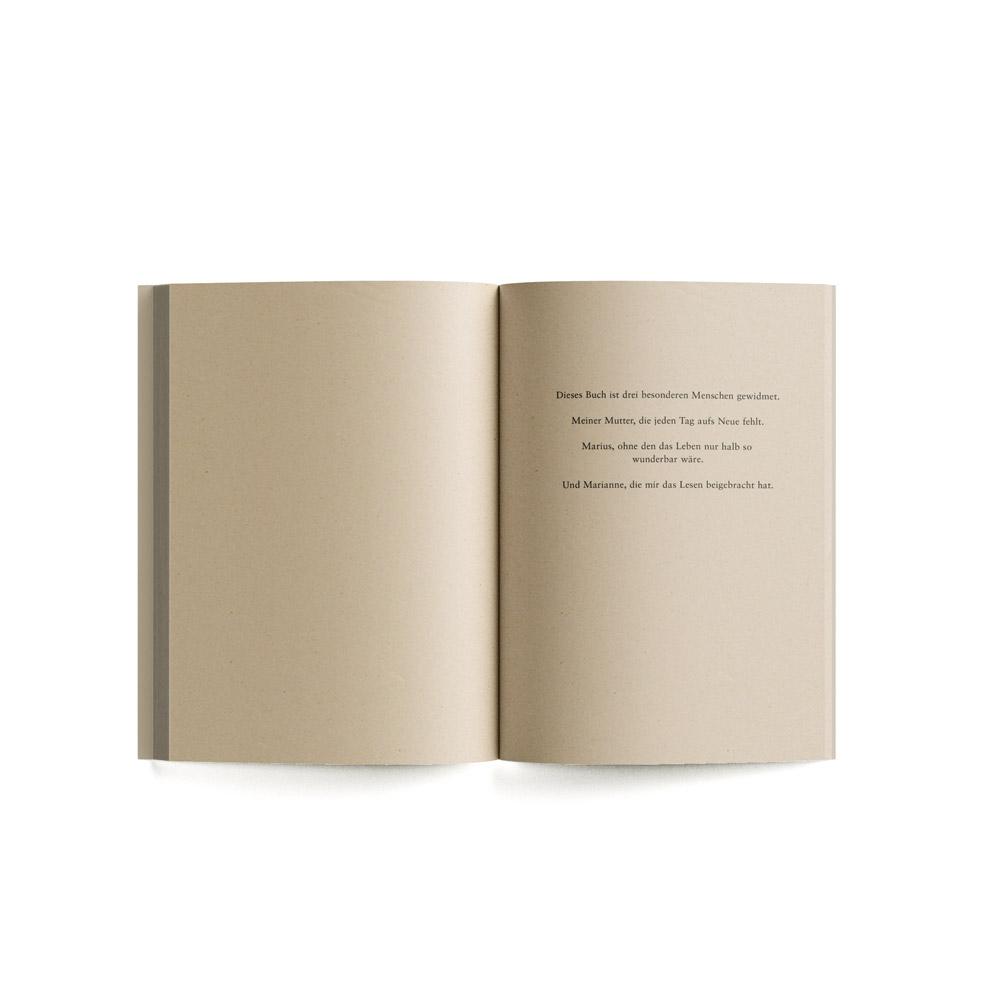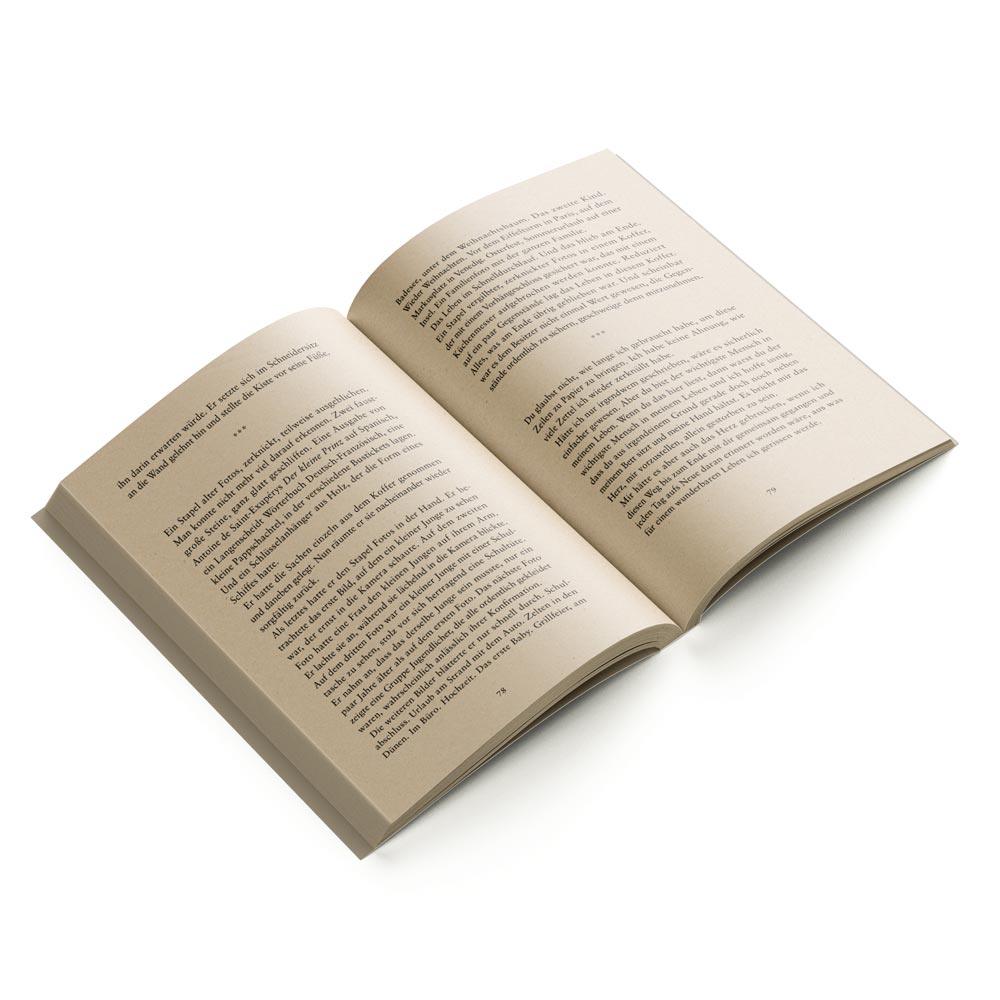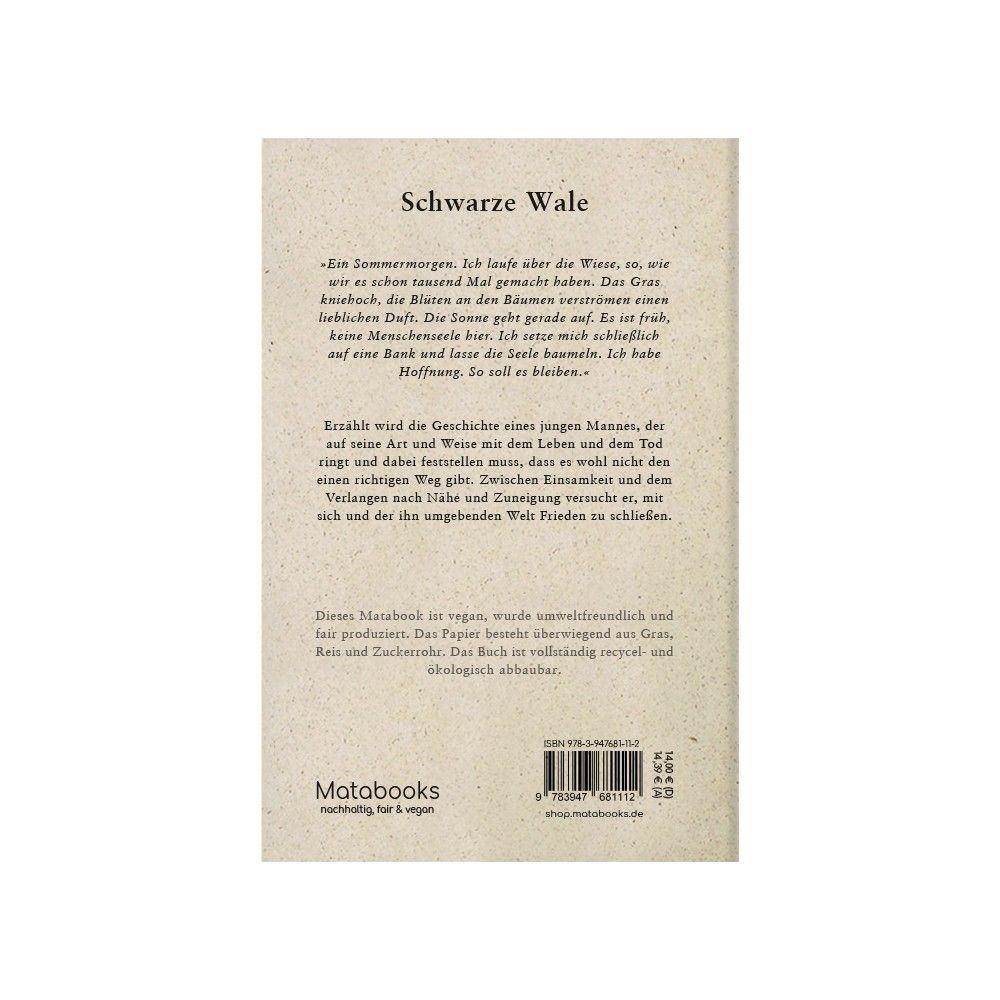Beschreibung
Schwarze Wale
„Ein Sommermorgen. Ich laufe über die Wiese, so, wie wir es schon tausend Mal gemacht haben. Das Gras kniehoch, die Blüten an den Bäumen verströmen einen lieblichen Duft. Die Sonne geht gerade auf. Es ist früh, keine Menschenseele hier. Ich setze mich schließlich auf eine Bank und lasse die Seele baumeln. Ich habe Hoffnung. So soll es bleiben.“
Erzählt wird die Geschichte eines jungen Mannes, der auf seine Art und Weise mit dem Leben und dem Tod ringt und dabei feststellen muss, dass es wohl nicht den einen, richtigen Weg gibt. Zwischen Einsamkeit und dem Verlangen nach Nähe und Zuneigung versucht er, mit sich und der ihn umgebenden Welt Frieden zu schließen.
Leseprobe
Ursprünglich war der Plan gewesen, wieder zu verreisen. Wohin auch immer, nur weit weg. So weit weg wie möglich. Ein anderer Kontinent, andere Gesichter, eine andere Welt. Aber sie hatten ihm schnell gesagt, dass es dafür zu spät sei, dass er das streichen müsse von seiner Liste. Vorerst vergessen solle. Dann war er aus dem Zimmer gestürmt, um kurz darauf zu Hause zusammenzubrechen. Beim nächsten Termin wieder die gleiche Leier, man müsse jetzt handeln, schnell handeln, sonst sei es zu spät. Er konnte nur lachen. Jetzt. Schnell. Weshalb? Ob er den Ernst der Lage nicht verstanden hätte? Doch, doch, das hätte er. Er mache jedoch nicht den Eindruck. Das sei ja nun seine Sache. Lachen dürfe er ja wohl noch. Die Therapie, jetzt und schnell. Gerne doch, aber zuerst wolle er verreisen. Hochgezogene Augenbrauen, Kopfschütteln. Und wieder war er aus dem Zimmer gestürmt. Zuhause hatte er in seiner Wut die Schüssel auf dem Telefonschrank im Flur, in der Schlüssel und anderer Kram lagen, zerstört. Eine ganze Woche verließ er sein Bett nur für seine dringendsten Bedürfnisse. Die Scherben blieben liegen. Er wusste
nach einigen Tagen sogar, wo er nachts in der Dunkelheit hintreten konnte, ohne sich den Fuß aufzuschneiden. Dann wiederum spielte er mit dem Gedanken, sich mit Absicht den Fuß aufzuschneiden. Aber er würde ja nicht daran verbluten. Sich die Pulsadern aufzuschneiden, dafür fehlte ihm der Mut. Und ohnehin wollte er nicht einfach so später in der Wohnung aufgefunden werden. Halb verwest. Würdelos. Wenn ihn dann überhaupt jemand suchen kommen würde. Die gesamte Zeit über, die er die Wohnung nicht verließ, hatte er keinen Kontakt nach draußen. Nicht zu seinen Freunden, nicht zu seiner Familie. Nur zum Pizzaboten, der ihm täglich die immer gleiche Pizza brachte. Er war erstaunt darüber gewesen, dass der Akku seines Handys ganze zwei Tage durchhielt, ehe er sich verabschiedete. Von da an war es nicht einmal mehr möglich, ihn telefonisch zu erreichen. Als ihm selbst der Kontakt zum Pizzaboten zu viel wurde, traf er mit diesem die Vereinbarung, den Pizzakarton einfach vor die Tür zu stellen. Bezahlt hatte er ohnehin online. Am achten Tag riss ihn die Türklingel aus dem Schlaf. Er fuhr sich durch das strähnige Haar. Sein Rücken knackte, als er sich streckte. Der Pizzabote konnte das schlecht sein. Er lief zur Gegensprechanlage und hob ab. Ob er zu Hause wäre? Erschrocken hielt er den Hörer so weit weg vom Ohr, wie er konnte.
Sein Bruder habe schon gehört, dass er abgenommen habe. Er habe doch den Hörer in der Hand. Sie machten sich Sorgen. Was los sei? Sie erreichten ihn nicht. Niemand erreiche ihn. Sein Handy sei dauerhaft aus. Das sei nicht witzig, schon seit einer Woche habe ihn niemand gesehen. Leon habe gesagt, dass er mit den anderen unterwegs gewesen wäre? Er solle endlich etwas sagen, er wisse genau, dass er ihn höre. Ob er ihn verarschen wolle? Er sei extra von der Arbeit hergefahren. Er solle etwas sagen, damit er wenigstens wisse, dass er noch lebe. Ob er ihn für bescheuert halte? Er hielt den Atem an. Was er sich einbilde, er solle sich melden. Irgendwann verschwand sein Bruder schließlich. Wie aus einer Trance erwacht betrachtete er sich im Flurspiegel.
Tiefe, dunkle Augenringe im Gesicht, dasselbe zerknitterte Shirt seit über einer Woche ununterbrochen tragend, bemerkte er, wie schlecht er eigentlich roch. Er schämte sich vor sich selbst.
Er hängte den Hörer auf, ging ins Bad, zog T-Shirt und Boxershorts aus und stellte sich unter die Dusche. Seine Haut schien aufzuatmen, die Poren öffneten sich, der Dampf drang ihm in die Nase und belebte ihn. Er zog sich frische Sachen an, putzte seine Zähne und fegte alle Scherben im Flur auf. Restmüll, graue Tonne.
***
Er solle sich Hilfe holen. Hilfe? Ja, Hilfe.
Sein Gegenüber hatte ihn einen langen Augenblick eindringlich angesehen und geseufzt. Er wäre nicht der erste, der glaube, das allein zu schaffen. Schweigen. Er solle ihm glauben, er schaffe es sicherlich eine ganze Weile allein. Aber am Ende, da würde niemand allein sein wollen. Er wisse nicht, dass er ihn um Rat gefragt hätte. Er sei da, um ihn zu beraten. Er sei da, um seine Arbeit zu machen. Beide hatten eine Weile nichts gesagt. Die Zeiger der Wanduhr hatten so laut getickt, dass selbst der Lärm vom Flur übertönt worden war. Er solle es sich überlegen. Er habe sich entschieden.
***
Und als das mit dem Reisen nichts geworden war, hatte er sich nach einer neuen Wohnung umgesehen. In seiner alten konnte er nicht mehr bleiben, unmöglich. Er schmiss bei der nächsten Sperrmüllabholung so ziemlich alle Dinge auf die Straße. Den Rest spendete er der Wohlfahrt. Er behielt sein Bett und das Klavier. Für seine persönlichen Gegenstände hatte er eine große schwarze Kiste gekauft, in die er alles blind hineinwarf, was ihm noch etwas bedeutete. Die Kiste war am Ende nicht einmal bis zur Hälfte gefüllt. Als sein Besitztum soweit zusammengeschrumpft war, dass es auch in drei Umzugskartons hineingepasst hätte, rief er einen Makler an. Er hatte die Tageszeitung im Internet durchgeschaut und schließlich die Nummer gewählt, zu der das Bild am unseriösesten und wenigsten kompetent gewirkt hatte. Er suche eine Wohnung. Ob er sich auch präziser ausdrücken könne? Er interessiere sich für eine Einzimmerwohnung, so wenig Quadratmeter wie möglich. Ob er das richtig verstanden habe? Ein Zimmer und – ja genau, habe er. Und die Wohngegend, gerne ungemütlich. Nicht schön. Dreckig und trostlos, bitte sehr. In der Nähe des Krankenhauses. Aber die Stadt sei ja klein, habe er gehört, da sollte das wohl mach – bar sein. Machbar, ja, ungewöhnlich diese Wünsche. Aber er sehe, was er machen könne. Als er das Klicken am anderen Ende der Leitung hörte, wusste er, dass er sich auf ihn verlassen konnte. Die Stimme machte den gleichen Eindruck wie das Foto in der Zeitung.
In den folgenden Tagen traf er weitere Vorkehrungen. Er wanderte noch einmal auf einen der Berge, vergleichsweise wohl vielmehr ein größerer Hügel, in der Nähe ihrer Wohnung hinauf. Im Morgengrauen, um den Sonnenaufgang zu beobachten, die kühle Luft einzuatmen. Der Raureif bedeckte Blätter und Grashalme. Er harrte auf der Bank aus, mit geschlossenen Augen, und konzentrierte sich auf seine Atmung. Als er die Kälte in der Lunge spürte, stieg er wieder hinab und lief durch den Wald nach Hause. Er ging in sein Lieblingscafé, aß drei Stück Käsekuchen und trank Milchkaffee, bis ihm schlecht war. An einem Abend trank er in einer Bar so viel Bier, dass er auf dem Rückweg beinahe vom Fahrrad kippte und unter einer Straßenbahn landete. Er ging noch einmal ins Konzert. In die Oper. Und ins Theater. An seinem letzten Abend hatte er sich bei seinen Eltern zum Essen eingeladen. Sein Bruder war auch da. Er habe einen neuen Job, vorübergehend in einer anderen Stadt, einige Stunden weit entfernt, gen Süden. Schön sei es da, ließe sich sicherlich gut leben, wie lange, das wisse er nicht. Ein halbes Jahr vielleicht? Der Traum vom Café? Das sei natürlich noch geplant. Danach. Zu Ende studieren? Natürlich, er müsse ohnehin nur noch zwei Prüfungen ablegen. Er halte sie auf dem Laufenden. Bestimmt, das sei doch selbstverständlich. Alles ein wenig überstürzt. Ja, nette Kollegen, sehr vielversprechend. Und auf einmal war es schon sehr spät, er müsse los, ja, es sei sehr nett gewesen, er rufe an, ja. Danke für das gute Essen, danke, danke für alles, er melde sich. Umarmungen, Küsse. Als er dann auf seinem Fahrrad durch die dunkle Nacht zu seiner Wohnung fuhr, kamen ihm kurz die Tränen.
***
Er lieh sich ein Auto und verstaute all sein Hab und Gut, das nicht einmal die komplette Rückbank füllte. Er fuhr bei Sonnenschein los, kühle Luft. Das Bett und das Klavier waren von einem Umzugsunternehmen bereits abgeholt worden und auf dem Weg in seine Wohnung. Die gesamte Fahrt über schaltete er das Radio nicht ein, um die Ruhe zu genießen. Nach etwa zwei Stunden wurde die Landschaft um ihn herum hügeliger. Die ersten Berge tauchten am Horizont auf. Für einen kurzen Moment verspürte er Zufriedenheit. Als er sich jedoch wieder ins Gedächtnis rief, weshalb er gerade in dem Auto saß, verschwand das Gefühl wieder. Bei jedem Schalten in einen anderen Gang heulte der Motor auf. Das Auto kroch nur langsam die Berge hinauf, der Anstieg
wurde immer steiler. Auf einmal leuchtete eine kleine Lampe rot auf. Zu seiner eigenen Überraschung war er nicht wütend darüber, nicht einmal genervt. Er nahm es so hin und nahm sich vor, bald eine Werkstatt aufzusuchen. Da er ohnehin nur auf Landstraßen fuhr – er hasste Autobahnen – wollte er einfach im nächsten Dorf halten. Ein Schild mit der passenden Aufschrift zeigte auf den hinteren Teil eines Hofes. An einer Scheune waren große Buchstaben angebracht, jedoch fehlten in dem Wort die Buchstaben r, k und das letzte t. Ein alter Mann stand im Blaumann gebückt vor einem kleinen Traktor und hantierte mit diversen Werkzeugen herum. Er sprach ihn an. Der Alte grummelte etwas Unverständliches, ohne von dem Traktor aufzusehen. Ob er ihm vielleicht –? Er sage ja, kurzen Moment. Er habe zu tun. Er ging zurück zu seinem Wagen und setzte sich auf den Fahrersitz. Nach einer gefühlten Ewigkeit schaute er auf seine Armbanduhr. Zehn Minuten waren vergangen. Das Warten fühlte sich wie vom Schicksal eingefädelt an. Bis dahin hatte er den Plan nicht in Frage gestellt, hatte ihn für gut befunden und nur geradeaus geschaut. Doch jetzt kamen die Zweifel. Auf irgendeinem Hof in irgendeinem Dorf.
***
Wir bei Matabooks verwenden ausschließlich Rohstoffe aus Bioanbau und unsere Produkte sind “Made in Germany”. Das Gras für unser Papier kommt aus der Schwäbischen Alb und wird von Heubauern geerntet, sonnengetrocknet und schließlich zu Graspapier weiterverarbeitet. Matabooks sorgt für faire und soziale Arbeitsbedingungen in allen Unternehmensbereichen, zudem unterstützen wir Projekte mit ähnlichen Schwerpunkten. Dafür spenden wir einen Teil des Erlöses von jedem verkauften Buch an gemeinnützige Organisationen. Außerdem ermöglichen wir besonders kreativen jungen Menschen, ihre Werke und Arbeiten bei Matabooks zu veröffentlichen. All unsere Produkte haben recycelte Bestandteile und sind selbst recyclebar! Mit unseren Produkten unterstützen wir so das natürliche Geben und Nehmen im Lebenskreislauf. Der Name Matabooks leitet sich von dem Wort “Mutter” in der indischen Ursprache Sanskrit ab. Für uns ist es der Ausdruck von Respekt gegenüber “Mutter Natur”.
Ebenso wichtig für uns:
• Die Produktion unserer Bücher ist besonders ressourcenschonend. Der Buchdeckel besteht aus Graspapier (bis zu 50% Grasfaseranteil, Frischfaseranteil aus FSC-zertifizierten Wäldern). Die Seiten bestehen vollständig aus 100% kompostierbarem Süßgraspapier, welches aus Reis und Zuckerrohr hergestellt wird.
• Darüber hinaus ist unsere Produktion schadstoffreduziert und vegan. Wir achten stets auf ökologische und nachhaltige Produktion.
• Dafür verzichten wir auf Industrieklebstoffe wie PUR.
• Unsere Druckfarben sind frei von Mineralöl und bestehen aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen.