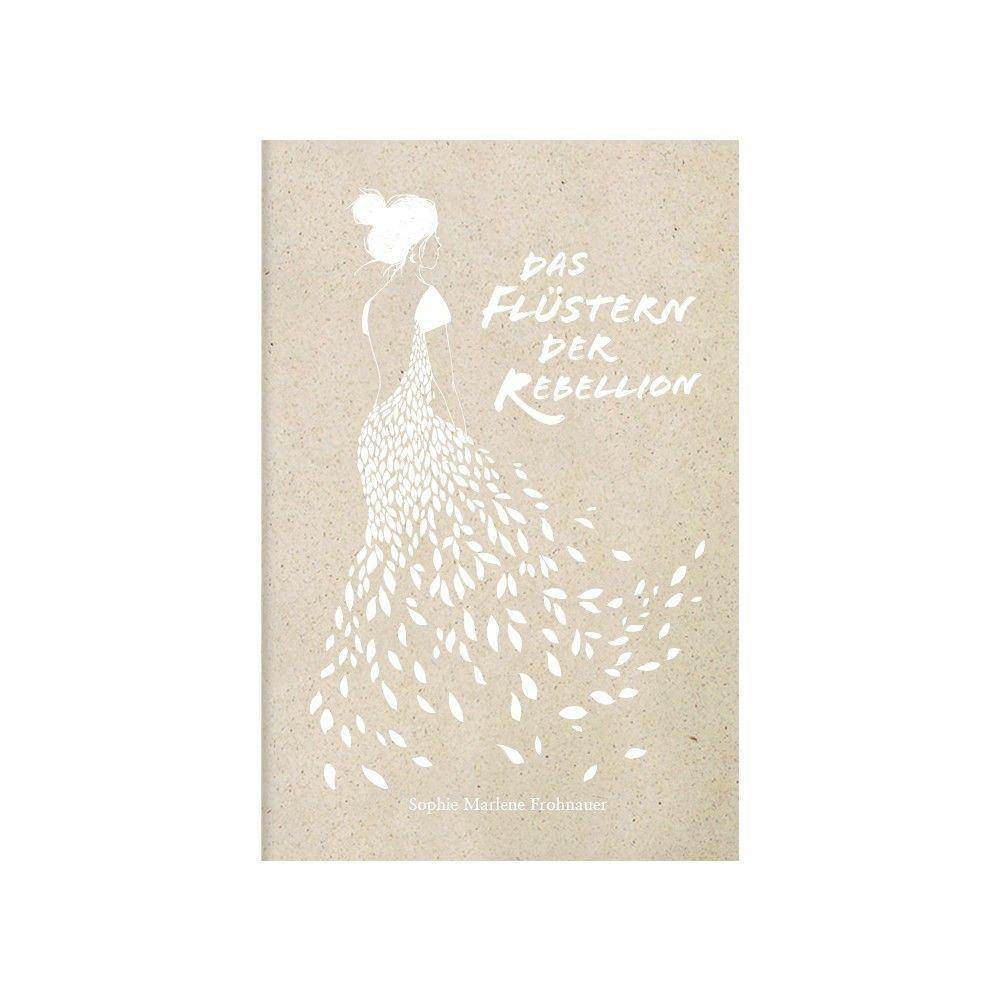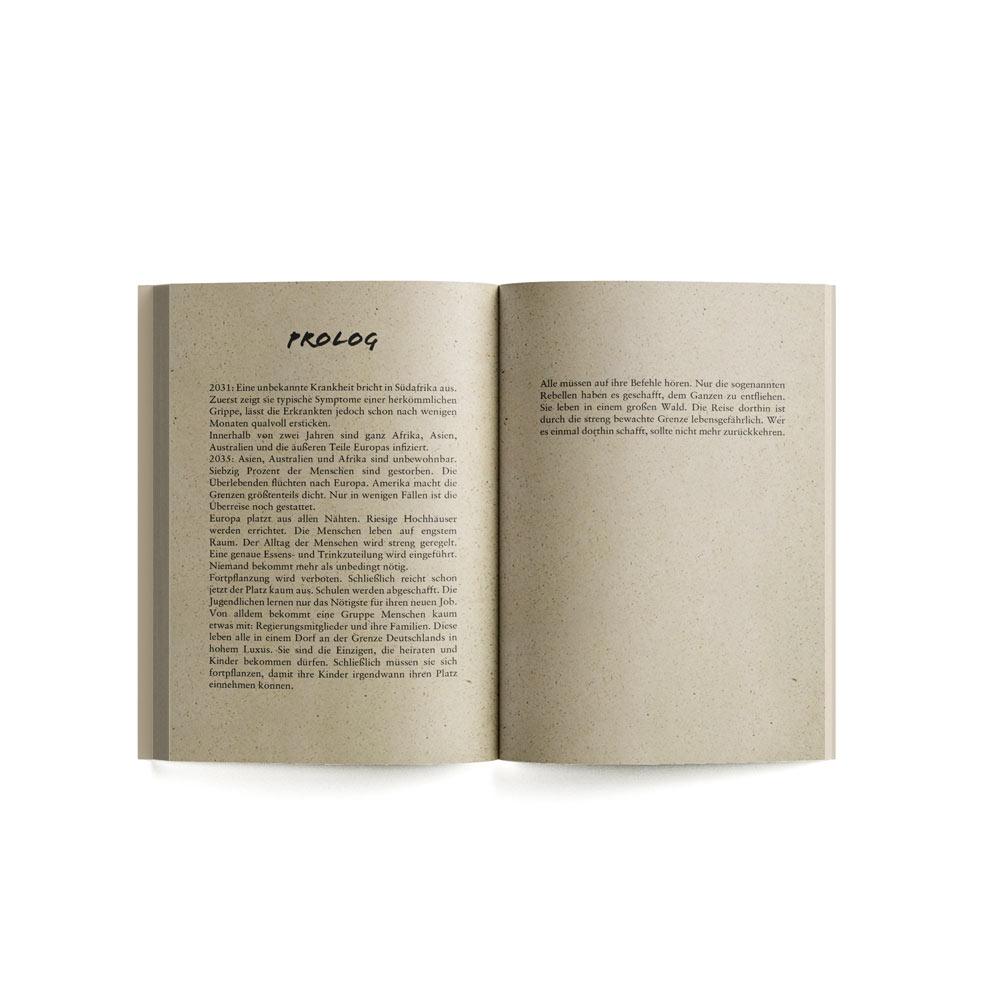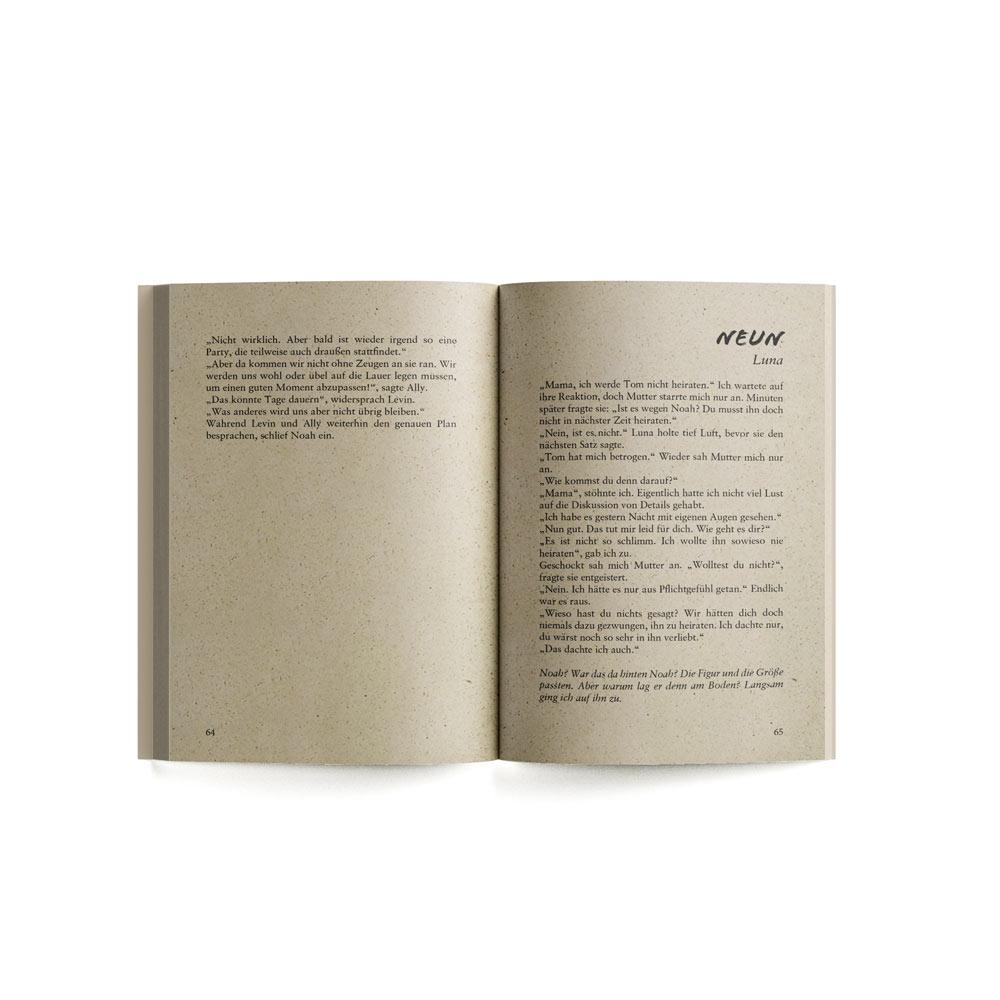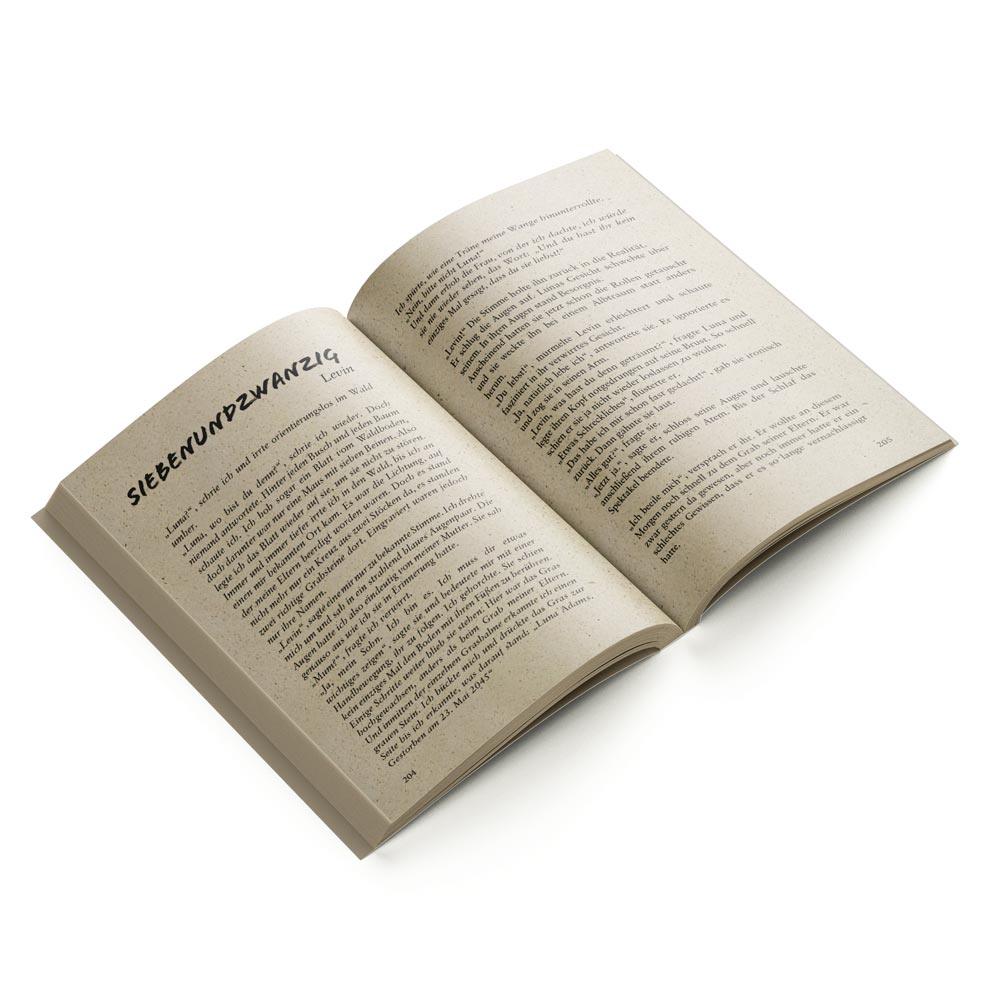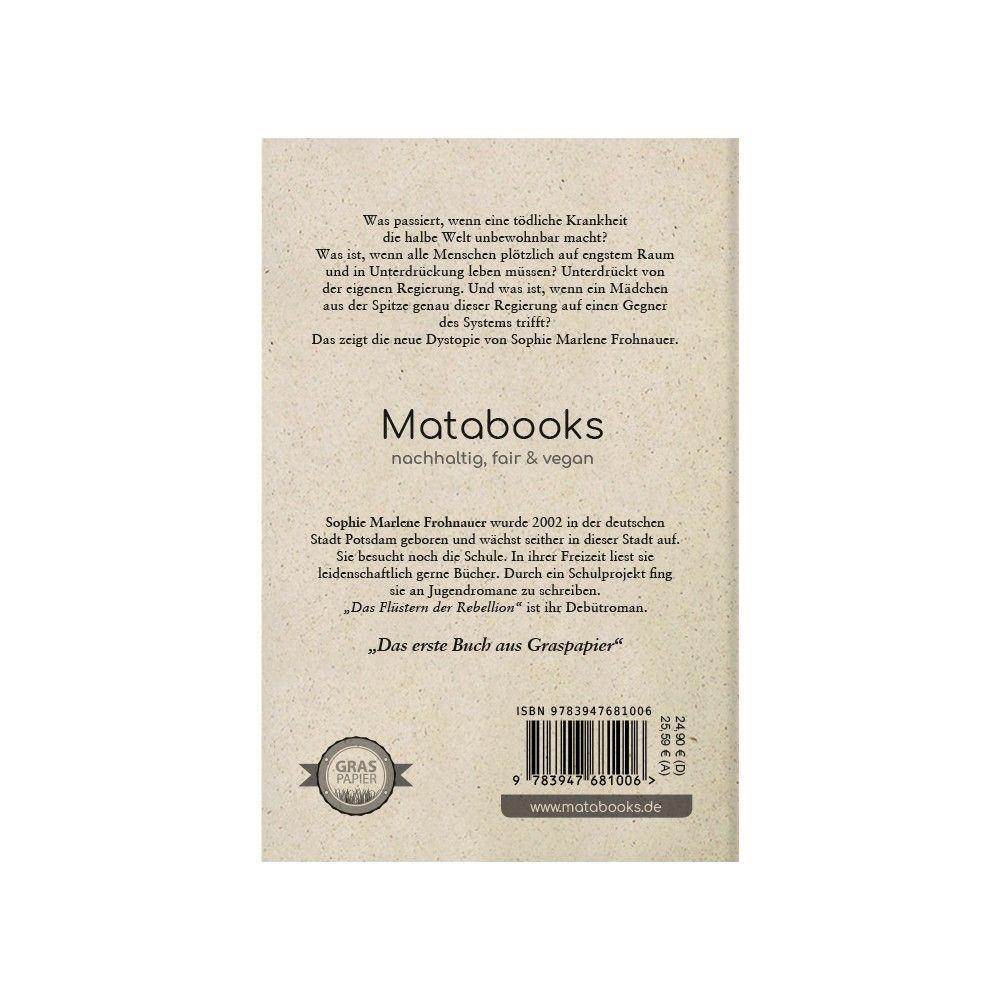Beschreibung
Das Flüstern der Rebellion – Jugendroman komplett aus Graspapier
Was passiert, wenn eine tödliche Krankheit die halbe Welt unbewohnbar macht? Was ist, wenn alle Menschen plötzlich auf engstem Raum und unterdrückt von der eigenen Regierung leben müssen? Und was geschieht, wenn ein Mädchen aus der Spitze dieser Regierung auf einen Gegner des Systems trifft? Das zeigt die neue Dystopie von Sophie Marlene Frohnauer.
Prolog
2031: Eine unbekannte Krankheit bricht in Südafrika aus. Zuerst zeigt sie typische Symptome einer herkömmlichen Grippe, lässt die Erkrankten jedoch schon nach wenigen Monaten qualvoll ersticken.
Innerhalb von zwei Jahren sind ganz Afrika, Asien, Australien und die äußeren Teile Europas infiziert.
2035: Asien, Australien und Afrika sind unbewohnbar. Siebzig Prozent der Menschen sind gestorben. Die Überlebenden flüchten nach Europa. Amerika macht die Grenzen größtenteils dicht. Nur in wenigen Fällen ist die Überreise noch gestattet.
Europa platzt aus allen Nähten. Riesige Hochhäuser werden errichtet. Die Menschen leben auf engstem Raum. Der Alltag der Menschen wird streng geregelt. Eine genaue Essens- und Trinkzuteilung wird eingeführt. Niemand bekommt mehr als unbedingt nötig.
Fortpflanzung wird verboten. Schließlich reicht schon jetzt der Platz kaum aus. Schulen werden abgeschafft. Die Jugendlichen lernen nur das Nötigste für ihren neuen Job.
Von alldem bekommt eine Gruppe Menschen kaum etwas mit: Regierungsmitglieder und ihre Familien. Diese leben alle in einem Dorf an der Grenze Deutschlands in hohem Luxus. Sie sind die Einzigen, die heiraten und Kinder bekommen dürfen. Schließlich müssen sie sich fortpflanzen, damit ihre Kinder irgendwann ihren Platz einnehmen können.
Alle müssen auf ihre Befehle hören. Nur die sogenannten Rebellen haben es geschafft, dem Ganzen zu entfliehen. Sie leben in einem großen Wald. Die Reise dorthin ist durch die streng bewachte Grenze lebensgefährlich. Wer es einmal dorthin schafft, sollte nicht mehr zurückkehren.
Leseprobe
EINS – Luna
„Wenn ich mich weiter drehe, wird mir noch schwindlig“,
jammerte ich und stoppte. Mutter lachte.
„Du siehst wunderschön aus in dem Kleid. Ich wollte
gerade sagen, es sei wie für dich gemacht, aber es wurde
ja wirklich nur für dich angefertigt“, grinste sie.
Sie zupfte etwas an meinem Kleid zurecht, bevor sie meine
Hand nahm und mich zum Spiegel zog.
Das beigefarbene Kleid reichte mir bis zu den Knien. Es
war schulterfrei und besaß einen herzförmigen Ausschnitt.
Emma, meine sogenannte persönliche Zofe, hatte mir
die Augen dunkel geschminkt. Laut Emma kamen meine
grünen Augen dadurch noch besser zur Geltung.
Mutter stand hinter mir und betrachtete stolz mein
Spiegelbild. Ich lächelte sie an.
„Wann kommen die Gäste?“, fragte ich.
„Sie sollten jeden Moment eintreffen.“ Erstaunt drehte
ich mich um.
„Ist das Essen fertig? Wo bleibt Tom? Ist Vater fertig?“
Nervös fasste ich mir an die Stirn. Heute kamen wichtige
Politiker. Einige Geschäfte, die Vater im Auge hatte,
standen auf dem Spiel, so dass wir alle unter Stress
standen.
„Ganz ruhig“, sagte Mutter. „Dein Vater ist schon
im Veranstaltungssaal, Tom sollte auch jede Sekunde
eintreffen und das Buffet ist fertig angerichtet. Du musst
nur gleich gemeinsam mit mir die Gäste begrüßen.“
Ich nickte zustimmend. Der Abend würde schon gut
werden. Ich würde jedem nett zulächeln, Small-Talk
halten, lächeln, Anstand zeigen, lächeln und versuchen
in den hohen Schuhen keine Blasen zu bekommen. Und
nicht zu vergessen: lächeln.
Am anderen Ende des Flures schwang die Tür zur
Eingangshalle auf und ein Mann des Wachpersonals
verkündete: „Tom Fasanerie ist da.“
Mutter nickte und scheuchte ihn mit einer Handbewegung
weg. Dann ging sie zur Eingangshalle.
„Na, komm! Worauf wartest du?“, fragte sie, während
sie über die Schultern zu mir zurückblickte.
Tom stand aufrecht im Eingangsbereich und strich
seine Anzughose glatt. Als er uns hereinkommen hörte,
drehte er sich um und lächelte. Zuerst war Mutter an
der Reihe. Küsschen links, Küsschen rechts. „Schön, Sie
wiederzusehen, Frau Adams.“ Sie nickte höflich, trat
dann zur Seite, um Tom den Weg zu mir freizumachen.
Er lächelte mich an und nahm mich für einen kurzen
Moment halbherzig in den Arm.
Tom und ich waren zusammen seit ich vierzehn und er
fünfzehn Jahre alt war. Im Laufe der Zeit wurde unsere
Beziehung immer ernster. Mittlerweile war er neunzehn
und ich fast achtzehn Jahre alt.
Ich drückte mich an ihn, bis es einige Momente später an
der Tür klopfte.
Tom löste seinen Griff und wir stellten uns nebeneinander,
bereit, die eintreffenden Gäste zu begrüßen. Mutter trat
vor uns. Der Wachmann öffnete die Tür.
„Kommen Sie doch rein“, säuselte er, während ein
Lächeln seine Lippen schmückte.
Eine hochgewachsene, blonde Frau kam herein. An ihrem
Arm hing ein kleiner, älterer Herr. Sie waren offensichtlich
ein Paar, obwohl sie deutlich jünger aussah.
„Ach, Frau Almond. Wie schön, Sie heute hier begrüßen
zu können“, sagte Mutter viel zu überbetont. Ich musste
mich dazu zwingen mein Lächeln zu halten.
Und wieder das gleiche Prozedere wie bei Tom: Küsschen
links, Küsschen rechts.
Und dann bei mir. Nur, dass ich rechts anfangen wollte,
so dass wir gegeneinander stießen. Mein Kopf wurde
tomatenfarben, bevor wir es noch einmal versuchten.
Diesmal fing auch ich links an.
„Schön, dich zu sehen, Luna“, sagte sie, grinste und
überspielte damit so gut wie nur möglich das Missgeschick
von eben. Ich lächelte.
Ich begrüßte noch ihren Mann, bevor der Wachmann die
beiden zum Veranstaltungssaal begleitete.
Als er gerade durch die Tür zurück kam, klopfte es
erneut. Er stöhnte leise, aber so leise, dass man es kaum
hörte und öffnete ein weiteres Mal die große Eingangstür.
„Guten Tag. Schön, dass Sie da sind”, sagte er.
Der Veranstaltungssaal war gut gefüllt. Jeder Platz an
der großen Tafel war besetzt oder es hing zumindest die
Jacke einer Person über der Stuhllehne.
Vater saß an einer der Spitzen der Tafel. Daneben
meine Mutter und auf seiner anderen Seite waren mein
und Toms Plätze. Vater hatte kurze graue Haare. Seine
Augenbrauen wiederum waren tiefschwarz. Er hatte ein
markantes Kinn und genauso markante Wangenknochen.
Sein Gesichtsausdruck war streng, egal wie sehr er sich
auch bemühte. Ich sah ihm überhaupt nicht ähnlich.
Als ich neben Tom in den Saal kam, unterbrach Vater
kurz seine Unterhaltung und schaute auf. Er nickte uns zu
und setzte sein Gespräch mit einer älteren Dame in einem
roten Mantel fort.
„Willst du etwas essen?“, fragte mich Tom. Er hatte
seinen Arm um meine Hüfte gelegt.
„Nein, lass uns erstmal hinsetzen, bitte.“
Ich nahm seinen Arm von meiner Hüfte und verschränkte
unsere Hände ineinander. Wir liefen eng nebeneinander
zu unseren Plätzen. Er erzählte mir von seinem Gespräch
mit seinem Vater. Hin und wieder wurde er von
Gästen unterbrochen, die uns begrüßten und mich mit
Komplimenten überhäuften.
„Schönes Kleid, Luna!“
„Ihre Haare sitzen heute wirklich gut!“
„Eine Schönheit, wie ihre Mutter.“
Tom lächelte jedem kurz zu, bevor er mit seinem
angeregten Monolog fortfuhr.
„Vielleicht nimmt er mich ja auch mal mit. Ich will endlich
mal wieder eine Weile raus aus Deutschland, weißt du?“
Ich hörte ihm nur halb zu. Ab und zu nickte ich, als
würde ich verstehen und ihm absolut zustimmen. Meine
Konzentration widmete ich jedoch eher der Berührung
unserer Hände.
Tom löste seine Hand aus meiner und schob meinen
Stuhl zurück. Ich lächelte und nahm Platz. Tom setzte
sich neben mich.
„Ihre Tochter ist ja groß und so hübsch geworden.
Unglaublich, wie die Zeit vergeht.“ Ich schaute auf. Die
alte Dame mit dem roten Mantel grinste mich an. Erst
jetzt fiel mir auf, dass ihr Gesicht viel zu stark geschminkt
war. Ihre Wangen leuchteten förmlich.
„Ja, sie ist mein ganzer Stolz. Und bald ist sie bereit, eine
echte Politikerin zu sein“, lachte Papa fröhlich. Trotzdem
sah sein Gesicht streng aus.
Ich wurde rot und schaute nach unten. Plötzlich kam mir
der Boden äußerst interessant vor. Er bestand aus weißen
Marmorfliesen, gespickt mit grauen Akzenten. An den
Wänden standen große weiße und dicke Säulen, an
denen sich goldene Figuren hochhangelten. Die Mitte der
Decke bestand aus Glas. Würde die Sonne noch scheinen,
so würde der ganze Saal vor Tageslicht nur so glänzen.
Doch nun konnte man „nur“ die Sterne und den Mond
am Himmel beobachten.
„Luna? Spielst du später eigentlich wieder Klavier für
uns?“, fragte die hohe Stimme der älteren Dame mit
rotem Mantel und zu viel Schminke.
„Ja, natürlich.“ Ich lächelte sie an, so wie ich es immer
wieder eingebläut bekommen hatte.
„Wie lange spielst du jetzt schon Klavier?“, löcherte
sie mich weiter. Ich schnappte mir Toms Hand unterm
Tisch. Ich war etwas nervös, denn ich kannte sie nicht
und wusste damit nicht, wie wichtig sie für zukünftige
Geschäfte war.
„Fast vierzehn Jahre“, antwortete ich. Ich war froh, dass
man die Unsicherheit in meiner Stimme offensichtlich
nicht heraushörte.
„So lange schon?“, staunte sie.
„Ja, meine Eltern haben mich seit ich vier Jahre alt war
ans Klavier gesetzt.“ Aus irgendeinem Grund fing die
Frau plötzlich an zu lachen. Vater stimmte in ihr Lachen
ein. Wenn man ihn jedoch kannte, dann wusste man, dass
auch er keine Ahnung hatte, worum es ging. Ich kicherte
nervös mit und Tom gluckste neben mir.
„Diese Eltern, die denken, ihre kleinen Kinder schon so
früh wie möglich fördern zu müssen, damit sie etwas
erreichen und ja keine Kindheit haben.“ Vater hörte auf
zu lachen. Sie jedoch lachte immer lauter. Die Tränen
standen ihr schon in den Augen. Vater räusperte sich
nervös.
Die Frau mit dem roten Mantel und zu viel Schminke
beruhigte sich allmählich wieder.
„Es tut mir wirklich leid, Herr Adams, bitte entschuldigen
Sie diesen Ausbruch des schlechten Benehmens“, beteuerte
sie bevor sie aufstand, ihre Klamotten glatt strich und mit
einem Nicken in der Menge verschwand.
Verwirrt schüttelte Vater den Kopf. Er stand auf,
tätschelte mir die Schulter und sagte: „Wenn ihr mich nun
entschuldigt.“ Dabei sah er Tom in die Augen, welcher
nur nickte und lächelte. So wie jeder hier. Daraufhin
verschwand auch Vater in der Menge.
Ich legte meinen Kopf leicht auf Tom´s Schulter, immer
darauf bedacht, meine Frisur nicht zu zerstören.
„Was war das denn eben?“, fragte ich.
„Ich habe keine Ahnung.“ Er lachte.
„Und nun freue ich mich sehr, Ihnen meine Tochter
anzukündigen. Sie spielt für uns das großartige Werk
Für Elise von Beethoven“, kündigte mein Vater an.
Oh ja, es war großartig. Man könnte sagen, dass es mein
Lieblingsstück war. Obwohl viele Werke von Beethoven
einfach zum Dahinschmelzen waren. Jedenfalls für wahre
Musikliebhaber.
Ich stand auf, ging auf die Bühne und setzte mich an den
weißen Flügel. Bewusst schaute ich nicht nochmal zurück.
Das würde mich nur nervös machen. Man spürte nämlich
die Autorität, die von jedem in diesem Saal ausging.
Ich legte die Notenblätter zurecht, räusperte mich und
fing an zu spielen.
Bei den schnelleren Stellen ging ein Raunen durch das
Publikum. Vereinzelt wurde auch kurz geklatscht.
Ansonsten herrschte Stille im Publikum.
Ich genoss den letzten Takt des Stückes bevor ich meine
Finger still auf den Tasten liegen ließ und dem Applaus
lauschte.
Vater kam wieder auf die Bühne. Er nahm meine Hand,
ich stand auf und wir gingen gemeinsam in die Mitte der
Bühne, wo ich einen leichten Knicks machte, was mir
einen noch viel größeren Applaus einbrachte.
Ich lächelte, diesmal unbewusst.
„Und bevor meine geliebte Tochter die Bühne verlässt,
haben wir noch ein Anliegen. Tom, komm doch bitte auf
die Bühne“, forderte Vater Tom auf. Verwirrt starrte ich
abwechselnd auf Vater, der die Bühne nun verließ und
auf Tom, der an seiner Stelle zu mir kam.
Tom stand vor mir. Etwa einen Meter Abstand. Er atmete
tief durch. Ich schaute zu Mutter. Auch sie schien nicht
zu wissen, was gerade geschah.
Und dann passierte etwas, womit ich niemals gerechnet
hätte. Vielleicht hätte ich es aber tun sollen. Tom zog
eine kleine Schmuckschatulle aus seiner Anzugjacke und
kniete vor mir nieder. Ab diesem Zeitpunkt wusste so
gut wie jeder im Saal was als nächstes kam. Tom öffnete
die Schatulle. Darin lag ein silberner Ring, an dem ein
kleiner, glänzender Diamant steckte. Ich erkannte zwar
eine Gravierung, aber nicht die einzelnen Worte.
„Luna Adams? Willst du, die große Liebe meines Lebens,
meine Frau werden?“ Toms Stimme war fest, doch
trotzdem hörte man eine gewisse Unsicherheit heraus.
Die Freude, die ich im ersten Moment verspürte, wurde
schnell durch tiefe Zweifel ersetzt.
Ich hatte nur Sekunden, um die bisher schwerste
Entscheidung meines Lebens zu treffen. Ich konnte
jetzt schlecht Nein sagen. Erstens waren hier so viele
Menschen. Zweitens erwarteten meine Eltern doch,
dass ich Ja sagen würde. Schließlich war auch Tom ein
wichtiges Mitglied in der Politik. Falls ich später den
Posten meines Vaters übernehmen und damit eine der
wichtigsten Politikerinnen Europas sein würde, so wäre
Tom eine entscheidende Hilfe.
Und eigentlich liebte ich ihn doch auch, oder? Obwohl
ich mir dabei nicht mehr ganz so sicher war.
Sag nein!, schrie mein Herz.
Du musst ja sagen!, entgegnete mein Kopf.
Bitte tu dir das nicht an. Sag nein!, schrie mein Herz
wieder.
Die Gäste wurden langsam unruhig. Und Tom schaute
mich immer ängstlicher an. Bereute er es, mich gefragt
zu haben?
Jetzt tu es. Es muss sein!
Also öffnete ich den Mund und holte Luft, um eine
Antwort zu geben, die wahrscheinlich alles verändern
würde.
„Ja, ich will!“
ZWEI – Levin
„Ich weiß nicht, Levin. Im Moment ist die Überreise zu
riskant. Es werden mehr Wachposten aufgestellt. Du
würdest verletzt, wenn nicht sogar getötet werden“,
zweifelte Ally.
„Aber ich muss darüber. Der Bote hat heute Morgen
gesagt, er hätte mehr darüber herausgefunden, wo meine
Eltern früher gelebt haben“, drängelte Levin.
„Ich weiß, ich weiß. Ich kann ja auch verstehen, dass du
den wenigen Spuren, die von deinen Eltern geblieben sind,
nachgehen willst. Aber du willst doch auch weiter hier
als Rebell leben. Du hast selbst immer gesagt, du wirst
irgendwann zusehen wie die Regierung untergeht und die
Welt wieder zu einem besseren Ort wird. Dafür musst du
aber am Leben sein.“ Ally stand auf und ging auf und ab.
Sie schien angestrengt über etwas nachzudenken.
„Das ist doch doof“, fluchte Levin und warf einen Stein
in den Fluss.
„Ich weiß. Aber ich weiß auch, dass wir irgendwann
wieder in vollkommener Freiheit leben werden, keine
Abstriche machen müssen. Aber es bringt nichts, sich in
den Tod zu stürzen.“
„Ich vermisse sie“, raunte Levin.
„Ich weiß“, antwortete Ally. Sie setzte sich neben ihn und
legte ihren Kopf auf seiner Schulter ab.
Levin war als Jugendlicher gemeinsam mit seinen
Eltern in diesen Wald geflüchtet. An der Grenze wurde
seine Mutter angeschossen. Doch er hatte seinen Eltern
versprochen weiterzurennen, egal was passieren sollte.
Sein Vater war später zur Grenze zurück gegangen, um
nach seiner Frau zu schauen. Auch er kam nicht mehr
zurück. Damals war Levin zwölf Jahre alt. Verzweifelt
irrte er dann im Wald herum und traf auf Ally. Sie hatte
sich ein Lager aufgebaut, in dem Levin seither mit ihr
lebte. Später hatten die beiden Levins Eltern an der
Grenze gefunden. Beide erschossen. Sie haben sie auf
einer Lichtung in der Nähe des Lagers begraben.
Das war jetzt sieben Jahre her. Mittlerweile war er
neunzehn und Ally einundzwanzig.
„Ich vermisse sie so sehr.“ Levin legte seine Arme um
Ally und schloss die Augen.
Ally hatte rotbraune Haare. Ihr blasses Gesicht war
bedeckt von unzähligen Sommersprossen. Wie um ihre
Schönheit zu unterstreichen, hatte sie dazu noch strahlend
grüne Augen und einen schlanken, gut gebauten Körper.
Durch das Leben im Wald zeichneten sich überall leicht
Muskeln ab. Aber auch Narben ließen sich auf ihrer Haut
erkennen.
Obwohl nicht nur ihr Aussehen, sondern auch ihr
Charakter wunderschön war, hatte sich Levin nie zu ihr
hingezogen gefühlt. Er sah sie schon immer als Schwester.
„Seelenverwandte“ würde es jedoch auch treffen. Aber
wie hätte es auch anders kommen sollen, nachdem die
beiden schon so lange zusammen lebten? Die ersten
Jahre hatten sie nur sich gehabt, um über alles zu reden.
Mittlerweile hatte sich nicht nur ihr Lager, sondern
auch die Zahl ihrer Mitmenschen vergrößert. Mehrere
Menschen stießen im Laufe der Zeit zu ihnen. Einige
gingen wieder. Annemarie, Nelly und Lucas blieben.
Mittlerweile lebte auch das dreijährige Kind von Nelly
und Lucas namens Annabell bei ihnen.
„Warst du heute schon bei ihnen?“, fragte Ally.
„Nein, ich gehe später.“ Seit Jahren ging Levin fast jeden
Tag zum Grab seiner Eltern, egal wie schlecht das Wetter
war, egal wie komisch es Manchen vorkam. Er redete
auch mit ihnen. Das könnte keiner verstehen, der nicht
selbst einen großen Verlust hatte einstecken müssen.
Trauer war stärker als jedes andere Gefühl. Es zerstörte
die glücklichen Momente und Gefühle. Es fraß einen von
innen heraus auf.
„Ich muss gleich noch Beeren sammeln gehen. Annemarie
braucht noch ein paar mehr Zutaten fürs Abendbrot“,
berichtete Ally. Die beiden erreichten Seite an Seite das
Lager.
Dieses Lager lag mitten im Wald. Ally und Levin, später
auch die Anderen, hatten es geschafft, Baumhäuser
verschiedener Größen in den Bäumen zu errichten.
Verbunden wurden sie mit Holztreppen. Optisch sah
alles nicht wirklich professionell aus, aber es reichte
zum Leben. Nur eine große Hütte stand am Boden.
Darin war ein kleiner Raum mit den Vorräten sowie eine
provisorisch errichtete Küche mit Esstisch.
Zusammen hatten sie es sogar geschafft, eine
Wasserleitung zum Fluss zu bauen. Sie hatten kein warmes
Wasser (außer es wurde über dem Feuer erhitzt) und auch
nicht immer das sauberste. Aber auch hier reichte es aus,
um davon zu leben.
„Soll ich dir dabei helfen?“, fragte Levin.
„Nein. Es wird bald dunkel und du wolltest auch noch
zu deinen Eltern. Ich schaffe das schon ganz gut alleine.“
„Jetzt, wo du es sagst. Ich denke, dann mach ich mich
gleich nochmal auf den Weg. Wir sehen uns ja dann
später.“ Levin wuschelte Ally durch die Haare, so wie es
große Brüder immer taten. Dann drehte er um und ging
wieder in Richtung Fluss.
An der Stelle, an der Levin vorhin mit Ally gesessen
hatte, hielt er einen Moment an und schaute auf die
Wasseroberfläche. Sah man ganz genau hin, dann
erkannte man kleine Fische im Wasser. Deutlich leichter
zu erkennen war sein Spiegelbild. Seine Haare waren
zerzaust, als ob er gerade aus dem Bett gestiegen wäre.
Sie hatten irgendeine Farbe zwischen dunkelbraun und
schwarz. Seine hohen Wangenknochen waren deutlich
zu sehen. Seine leicht gebräunte Haut passte zu seinen
braunen Augen. Doch sein Gesicht schien ernst. Egal ob
er es war oder nicht.
Seine Haut war noch gezeichneter von Narben als die von
Ally. Er war stolz auf jede einzelne. Wieder etwas, das ihn
von Ally unterschied.
Auch bei ihm zeichneten sich deutlich die Muskeln unter
seiner Haut ab. Er war nicht überdurchschnittlich groß.
Sie hatten keinen Zollstock oder ähnliches. So konnten
sie alle nur schätzen. Annemarie meinte, er sei ungefähr
1,90 m groß.
Damit war Levin zwar der größte der Gruppe, aber er
war felsenfest davon überzeugt, dass sein Vater größer
gewesen war.
Er setzte seinen Weg fort. Viel laufen musste Levin nicht
mehr. Innerhalb von fünf Minuten war er an seinem
gewünschten Ziel: Die Lichtung, auf der seine Eltern
begraben lagen.
Das Gras war sehr hochgewachsen. Es reichte Levin fast
bis zu seinem Becken. Doch ein Trampelpfad erleichterte
Levin den Weg zu den Gräbern. Es gab keinen Grabstein
oder so etwas. Levin hatte lediglich ein kleines Kreuz aus
zwei Stöcken gebastelt und legte immer wieder frische
Blumen daneben.
Er setzte sich im Schneidersitz neben das Grab. Ersteinmal
sagte er nichts. Beobachtete nur einen kleinen Spatzen in
den Bäumen. Dann fing er an zu reden: „Hey Mum. Hey
Dad. Ich bin so kurz davor, etwas Neues über euch zu
erfahren und doch soweit davon entfernt. Ich wünschte,
ihr könntet mir helfen. Wieso können Engel eigentlich
nicht auf die Erde kommen und mit den Verbliebenen
reden? Das würde alles so viel leichter machen. Aber
vielleicht sind Engel zu schön dafür. Vielleicht macht der
Tod ja so schön, dass die Menschen die Verstorbenen gar
nicht wiedererkennen würden?“
Er strich mit einem Finger über das Kreuz, die Blumen, die
Erde, unter der die Menschen lagen, ohne die er nicht hier
wäre. Er war sich ganz sicher, dass er sich damals gut mit
seinen Eltern verstanden hatte. Nicht viele Erinnerungen
aus der Zeit waren übrig geblieben. Er wusste noch,
dass sie beide die Gerechtigkeit und den Frieden geliebt
hatten. Er hatte mal eine Prügelei mit einem Jungen
gehabt. Das war in der 3. Klasse gewesen. Sie hatten sich
um die Aufmerksamkeit eines Mädchens geprügelt. Der
andere Junge musste ins Krankenhaus. Als Levins Mutter
das erfuhr, weinte sie und sein Vater sprach zwei Tage
lang überhaupt nicht mehr mit ihm. Levin hatte damals
ein sehr schlechtes Gewissen. Er besuchte den Jungen im
Krankenhaus und entschuldigte sich sehr oft bei ihm.
Seine Mutter hatte dann gesagt: „Es ist okay. Kein
Mensch ist ohne Aber.“ Damals hatte Levin das nicht
begriffen. Er lag oft Nächte lang wach, dachte über das
Gesagte nach.
Er verstand sich zwar trotzdem nie wirklich mit dem
Jungen und das Mädchen verabscheute Levin für seine
Tat, aber er war trotzdem froh, dass es so geschehen war.
Fehler konnte man nämlich auch als Erfahrungen
bezeichnen. Auch das hatte seine Mutter zu ihm gesagt.
Außerdem erinnerte er sich daran, dass seine Eltern nie
sauer wurden, egal wie viele schlechte Noten er nach
Hause brachte. Sein Vater sagte dann immer: „Du musst
entscheiden was dein Ziel ist. Für dieses Ziel solltest du
kämpfen. Und wenn es nicht dein Ziel ist zu studieren,
dann akzeptieren wir das auch. Es gibt noch so viele
andere Möglichkeiten, glücklich zu werden. Nutze sie
weise, mein Sohn.“
Zu der Entscheidung, ob er sein Abitur machen wollte oder
nicht, kam es nie. Das Schicksal funkte ihm dazwischen.
„Ich liebe euch“, flüsterte Levin, bevor er aufstand und
sich auf den Rückweg machte.
„Und? Was hast du heute zum Abendbrot gezaubert?“,
fragte Levin als er in die Küche kam und seine Jacke auf
einen der Stühle schmiss.
„Kartoffeln, Erbsen und Hähnchen. Das ist das, was der
Bote heute gebracht hat. Gewöhnt euch bloß nicht dran.
Bald gibt es wieder Beeren und Nüsse“, sagte Annemarie.
Sie tat gerade jedem seine Portion auf einen Teller und
goss Wasser in Gläser.
„Wo sind die anderen?“, fragte Levin, während er seine
Finger eingehend musterte.
„Ally wollte sich gerade nochmal frisch machen gehen.
Nelly und Lucas sind mit Annabell zum Fluss gegangen.
Annabell geht es immer noch nicht besser. Sie hat sich
mehrmals in der Nacht übergeben. Sie ist den ganzen
Tag lang schon schwach und trinkt kaum was. Unsere
Medikamente sind alle. Wenn es nicht bald besser
wird, müssen wir neue holen. Sie müssten auch gleich
wiederkommen. Sie wollten nur versuchen, Annabell ein
wenig abzulenken.“, antwortete Annemarie.
„Komisch. Ich hab sie gar nicht gesehen oder gehört als
ich zurück gekommen bin.“
„Vielleicht sind sie mal zu einer neuen Stelle gegangen?“
„Kann sein“, brummte Levin.
„Hier, dein Teller. Lass uns anfangen, sonst wird es noch
kalt.“
Annemarie setzte sich Levin gegenüber und gemeinsam
fingen sie an, das Essen in sich hineinzuschlingen. Es war
eine gute Abwechslung von ihrer sonstigen Nahrung und
machte ausnahmsweise mal richtig satt.
„Wie war dein Tag?“, fragte Annemarie.
„Gut“, log Levin.
„Meiner auch. Der Bote hat mir versprochen, dass nächste
Mal neue Klamotten für uns alle mitzubringen.“
„Schön.“
„Was ist los?“, fragte Annemarie misstrauisch.
„Was sollte schon sein?“, entgegnete Levin ohne es
auszusprechen.
„Ach nichts. Ich dachte nur…“ Doch was sie dachte,
erfuhr Levin nicht, da Annemarie einen Hustenanfall
bekam. Sie fasste sich an den Hals und Levin verstand. Er
stand auf und schlug ihr mehrere Male auf den Rücken.
Solange bis sie hörbar tief Luft holte.
„Danke!“, krächzte sie.
„Nicht dafür.“ Er nahm seinen Teller, packte ihn in die
Spüle und ging zur Tür.
„Du hast gut gekocht“, sagte er, bevor er die Hütte
verließ. Sein Baumhaus war ganz am Rand. Sie hatten es
auf eine riesige Birke gebaut.
Sobald er sich gewaschen und umgezogen hatte, legte er
sich ins Bett und schlief sofort ein.
Wir bei Matabooks verwenden ausschließlich Rohstoffe aus Bioanbau und unsere Produkte sind “Made in Germany”. Das Gras für unser Papier kommt aus der Schwäbischen Alb und wird von Heubauern geerntet, sonnengetrocknet und schließlich zu Graspapier weiterverarbeitet. Matabooks sorgt für faire und soziale Arbeitsbedingungen in allen Unternehmensbereichen, zudem unterstützen wir Projekte mit ähnlichen Schwerpunkten. Dafür spenden wir einen Teil des Erlöses von jedem verkauften Buch an gemeinnützige Organisationen. Außerdem ermöglichen wir besonders kreativen jungen Menschen, ihre Werke und Arbeiten bei Matabooks zu veröffentlichen. All unsere Produkte haben recycelte Bestandteile und sind selbst recyclebar! Mit unseren Produkten unterstützen wir so das natürliche Geben und Nehmen im Lebenskreislauf. Der Name Matabooks leitet sich von dem Wort “Mutter” in der indischen Ursprache Sanskrit ab. Für uns ist es der Ausdruck von Respekt gegenüber “Mutter Natur”.
Ebenso wichtig für uns:
• Die Produktion unserer Bücher ist besonders ressourcenschonend. Durch die Verwendung von Graspapier (bis zu 50% Grasfaseranteil, Frischfaseranteil aus FSC-zertifizierten Wäldern) reduzieren wir nicht nur Transportwege, sondern sparen auch mehrere Tausend Liter Wasser, 80% Energie und 75% CO2 ein. Wir setzen Wert auf kurze Wege.
• Darüber hinaus ist unsere Produktion schadstoffreduziert und vegan. Wir achten stets auf ökologische und nachhaltige Produktion.
• Dafür verzichten wir auf Industrieklebstoffe wie PUR und auf Isopropanol.
• Unsere Druckfarben sind frei von Mineralöl und bestehen wie unsere Klebstoffe aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen.